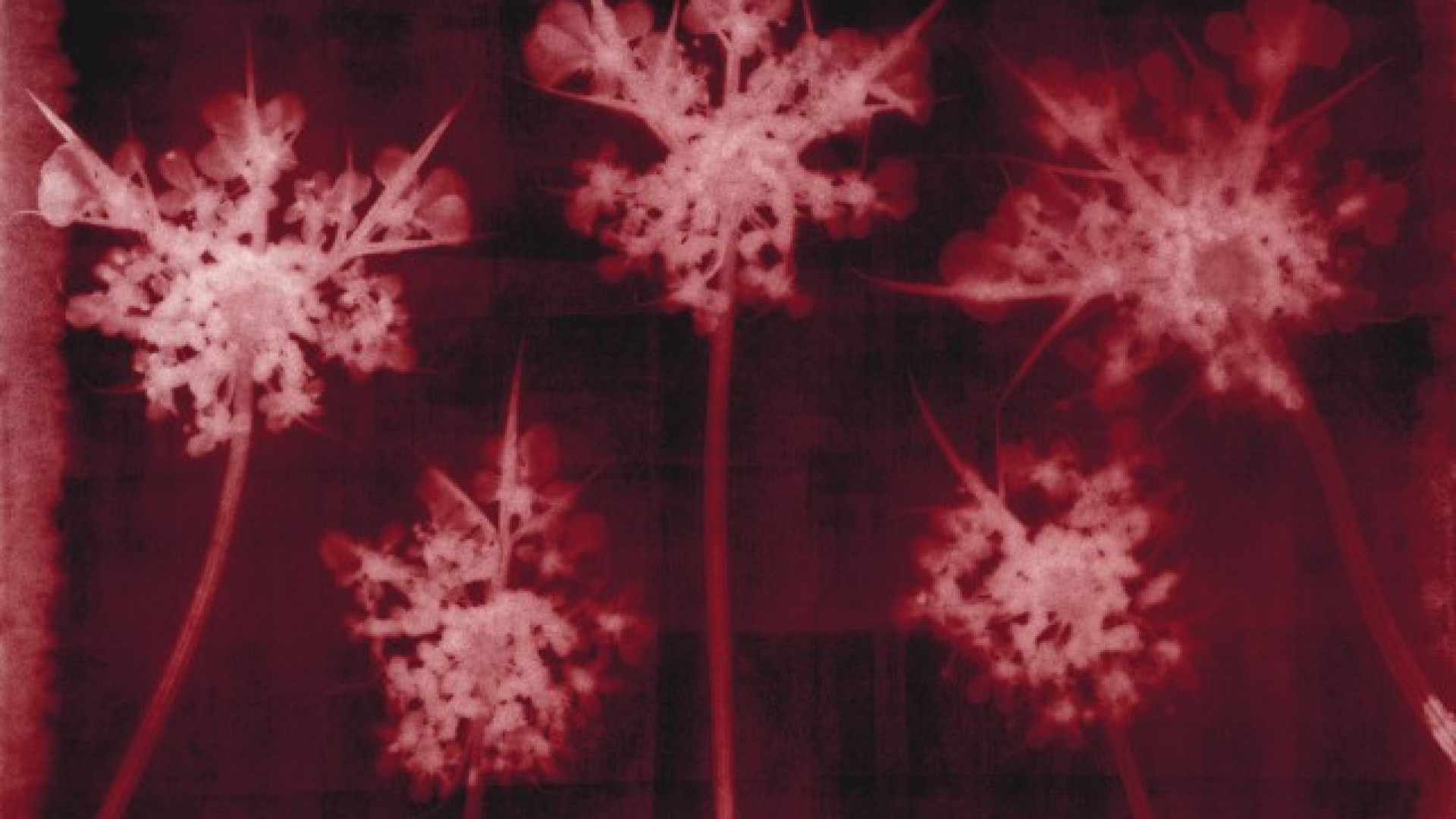Die Möglichkeit der Regeneration
Sue Stuart-Smith ist klinische Psychiaterin, Psychotherapeutin und Gärtnerin. Zusammen mit ihrem Mann, dem Landschaftsarchitekten Tom Stuart Smith, schuf sie während der Corona-Pandemie das Serge Hill Project für Gärtnern, Kreativität und Gesundheitsfürsorge. In diesem Jahr wird der Garten mit einer 1500 Arten umfassenden Pflanzenbibliothek für das Publikum öffnen. Ihr Buch «The Well Gardened Mind» («Vom Wachsen und Werden», Kopp-Verlag 2021) war in Großbritannien ein Bestseller.
Ein Gespräch über den Garten als Raum-Zeit-Medizin, als Kunstform und als Um-Lernort.
Interview: Astrid Kaminski
Sue Stuart Smith, wir sind verabredet, um über Gärtnern zu sprechen, aber es ist Winter. Eine unpassende Jahreszeit?
Es ist eine mystische Zeit. Einerseits ist es die Zeit, in der wir dem Tod am nächsten kommen, anderseits bereitet sich schon neues Leben im Unsichtbaren vor. Es ist ein Zeitraum der Transformation, in den wir uns versenken sollten, weil wir auf diese Art eine Gewissheit finden, dass es kaum so etwas wie einen absoluten Tod gibt – eine Lebensform stirbt und geht in eine andere über. Und doch ist das Auflösen der Form eine wichtige Erfahrung. Kreativität bedeutet etwas Neues zu gestalten. Der Antrieb dazu ist nicht in erster Linie der Wunsch, Altes zu überwinden, sondern eng mit der Erfahrung des Verlustes verbunden.
Anderseits sollten wir im Winter den Moment der «Planungslosigkeit» auskosten, diese kleine Zeitspanne, in der die Dinge zur Ruhe kommen und wir nicht über den übernächsten Schritt nachdenken müssen, sondern loslassen können. Es erfordert eine tiefe Erfahrung, das so erleben zu können. Wir können es nur empfinden, wenn wir uns als das, was wir sind, erfahren können: als Teil der Natur.
In Ihrem Bestseller «Vom Wachsen und Werden» zitieren Sie viele Studien, die den Effekt des Gärtnerns auf die psychische Gesundheit untersuchen. Welche Ergebnisse sind für Sie die wichtigsten?
Der wichtigste Aspekt für mich ist, dass Gärtnern Menschen sowohl jeglichen Alters als auch in vielen unterschiedlichen Schwierigkeiten oder Lebenskrisen helfen kann. Ich nenne den Garten zuweilen eine Raum-Zeit-Medizin. Dazu gehört das Gefühl der Einhegung in einem Garten: einen Schutzraum um sich zu haben, ohne eingeschlossen zu sein. Es ist eine Art Zwischenraumzustand: zwischen einem Zuhause und der Außenwelt zu sein. Dazu kommt der Zeitaspekt. Gärten können uns in die Kindheit versetzen, uns an die Großeltern erinnern lassen. Wenn wir jedoch am Arbeiten oder Beobachten sind, bringen sie uns ganz in den gegenwärtigen Moment. Die Aufgaben im Garten erfordern einen Fokus, eine Exaktheit. Oft sagen Menschen, dass sie sich, und damit ihre Sorgen, für eine Zeit verlieren. Der andere, sehr wesentliche Aspekt ist die positive Antizipation. Wir freuen uns auf das, was wir in der Zukunft erwarten. Das ist zum Beispiel sehr wichtig für Menschen, die mit einem Trauma, einem großen Verlust oder Angststörungen umgehen müssen. Durch positive Erwartungen entsteht Motivation, ein Sinn für die eigenen Ziele, was wiederum unser Dopaminsystem beeinflusst.
Sie erwähnen auch spezifische Studien wie zum Beispiel in Bezug auf Mikrobiome, die bei der Arbeit mit biologisch angereicherter Erde freigesetzt werden und sich positiv auf die Serotoninversorgung des Gehirns auswirken, also eine Art natürliches Antidepressivum sind.
Solche Wirkungen bestehen. Eine weitere wichtige Ebene ist die Tatsache, dass Gärtnern intrinsisch mit Qualitäten der Fürsorge zu tun hat und die diesbezüglichen Kapazitäten in unserem Gehirn die Endorphinproduktion beeinflussen, wodurch ein Gefühl der Entspannung und des Wohlfühlens entstehen kann. Darüber hinaus gibt es Effekte, die auf das Gärtnern wie auch auf viele andere Aktivitäten im Freien beziehungsweise im Grünen, zu verzeichnen sind – wie die Senkung des stressbedingten Cortisolspiegels. Das geht so weit, dass Menschen, die in der Nähe zu Gärten und Parks leben, eine bessere Stressresistenz haben.

Manche haben das Gefühl, dass Gärtnern eine Art Hausarbeit im Freien ist, eine ungeliebte Pflicht. Gibt es auch Menschen, die schlicht unerreichbar sind für die Vorzüge?
Ich war einer von ihnen… Nichts gilt für alle gleichermaßen. Dennoch hat Gärtnern tatsächlich ein großes Potential, Leute zu erreichen. Ich habe sehr viele Interviews mit Menschen geführt, die in therapeutischen- oder Communitygärten betätigen. Oft hörte ich, dass sie am Anfang keineswegs begeistert waren. Nach ein paar Monaten stellten sie jedoch fest, dass es ihnen hilft. Auch der soziale Aspekt spielt eine Rolle. Studien haben gezeigt, dass Menschen in Gärten, oder sogar in Räumen, in denen Zimmerpflanzen die Atmosphäre bestimmen, ein klein wenig netter zu einander sind. So kommt eine Auswertung der John Hopkins University aus den USA deutlich zu dem Ergebnis, dass der wichtigste Effekt des Community Gardenings in Städten der soziale ist. Menschen fühlen sich mehr verbunden, teilen die Freude über etwas zusammen.
Andererseits kommen nach Vorträgen regelmäßig Menschen zu mir, die sagen, dass sie das Gärtnern stresst. Dann frage ich: «Wie groß ist Ihr Garten und wie viel Zeit haben Sie in der Woche für ihn zur Verfügung?» Gärtnern ist wie alles im Leben: Wenn man sich zu viel vornimmt, kann es stressig werden. Eine Lösung wäre es, das Konzept zu verändern. Wir wissen, dass wir uns in einer Biodiversitätskrise befinden. Sinnvoll wäre es daher, nach anderen ästhetischen Standards, etwa solchen, die Insekten ansprechen, zu gärtnern. Dabei geht es nicht um akkurat gestutzte Hecken und Wiesen, sondern, im Gegenteil, um ein bisschen Wildheit, Laubabfälle, Holzscheite. Ich denke, wir befinden uns in Großbritannien in dieser Beziehung gerade in einer großen Umdenkphase.
Was macht einen Garten zum therapeutischen Garten beziehungsweise zu einem, mit dem man sich verbinden möchte?
Das Gefühl einer Einfriedung, was ich zuvor genannt habe, ist sehr wichtig. Auch das Gefühl, eine andere Welt zu betreten. Zudem braucht es unterschiedliche Bereiche: Arbeitsbereiche, aber auch solche, die zum Entspannen einladen, wo jemand allein mit der Natur sein kann. Es sollte ein Ort sein, an dem man sowohl aktiv als auch kontemplativ sein kann. Allein sein in einem Garten hat eine besondere Qualität. Man ist umgeben von Leben, aber muss sich nicht erklären oder etwas Schlaues sagen, sondern kann sich konzentrieren auf andere Beziehungsebenen.
Hier in Berlin wurde in diesem Jahr ein Palliativgarten am Charité-Krankenhaus eröffnet. Er wurde aus Spendengeldern finanziert. Bei den vielen positiven Effekten, die Sie in Ihrem Buch nennen, scheint es erstaunlich, dass Krankenhäuser solche Investitionen so schwer fallen. Wie ist das in Großbritannien?
In Bezug auf Hospize gibt es eine gewisse Gartentradition. Bei Krankenhäusern ist das weniger der Fall. Die Wohltätigkeitsorganisation Horatio's Garden kreiert jedoch role models und hat viel in dieser Richtung bewegt. Ja, ich kenne die Argumentation, dass Krankenhausgärten– trotz Erhebungen, dass sie unter anderem zu relevant früheren Entlassungen führen können – zu teuer zu unterhalten seien. In dieser Beziehung müsste zirkulärer gedacht werden. Bei Horatios zum Beispiel gibt es nur einen angestellten Gärtner, alle anderen sind Freiwillige. Dies sind Menschen, die keinen eigenen Garten haben, aber gerne einmal in der Woche darin arbeiten möchten. Dieses Prinzip wäre ausbaufähig. Es gibt so viele Menschen, die es nicht leisten können in einer Gegend mit eigenem Garten zu leben. Andererseits gibt es viele ältere Menschen, die sich um den ihren nicht mehr kümmern können. Statt öffentliche Grünflächen so billig wie möglich im Unterhalt zu machen, könnten sie durch Beteiligungsprinzipien funktionieren. Die Fürsorge könnte der Bürgerschaft übergeben werden! Klar, es erfordert Reife, Organisation und Logistik, aber ich denke, dies Qualitäten wären, bei einer Veränderung des mind-sets, verfügbar.

Was ich problematisch finde, ist das Ausdünnen der von Ihnen genannten Erkenntnisse zu therapeutischen Konzepten, die nicht viel mehr beinhalten, als: Umgang mit Natur und der Achtsamkeit ihr gegenüber tut gut. Vor einiger Zeit war ich in einer Reha und durfte, nein, musste, einmal in der Woche Holz riechen und Laub befühlen. Solche sinnlichen Erfahrungen zu machen, ist für viele selbstverständlich, und ich kam mir vor, als würde mir jemand Rechtschreibung beibringen.
Zu viele Vorgaben sind eher ein Hindernis. Auch würde ich keine Handleitungen herausgeben! Es geht nicht um ein «Rieche dieses und fühle jenes, und es geht dir besser». Ich denke, die besten therapeutischen Ansätze erlauben Menschen sich in ihrer eigenen Geschwindigkeit zu entwickeln. In meinem Buch gibt es das Beispiel einer jungen Frau in Italien, die gar nichts mit Gartenarbeit anfangen konnte, bis sie einen sterbenden Kaktus adoptierte. Es ging der Pflanze nach einer Weile besser, und durch dieses Erlebnis fand die Frau schließlich den Sinn in der Gartenarbeit.
Was braucht es, um Schönheit in einer Grünanlage zu erzeugen, beziehungsweise das Auge dafür zu öffnen und einen Impuls bei den Menschen anzusprechen, sich respektvoll zu verhalten?
Ich denke, es gilt hier etwas, was für andere Bereiche des Lebens auch zutrifft: Je größer die Diversität und Komplexität einer Grünanlage ist, desto interessanter wird sie. Diese Hypothese verweist auf ein eigentlich simples Gesetz: Was gut für den Planeten ist, ist auch gut für uns. Wenn immer dieselben, günstigen und widerständigen Pflanzen angebaut werden, dann ist das nicht nur langweilig, sondern ästhetisch gesehen ein Prinzip nach dem Motto: Wir bieten den Bürgerinnen eine Schuhgröße, die allen passen muss…
Schönheit ist ein wesentlicher Aspekt, sie hat, auch in anderen Erscheinungsformen, einen transformativen Effekt. Die Philosophin und Autorin Iris Murdoch schrieb das Buch «Die Souveränität des Guten», in dem sie der Schönheit einen Effekt von Selbst-Losigkeit oder Selbstentgrenzung zuspricht, so dass wir mit dem Gegenüber verschmelzen können und aus dieser Erfahrung revitalisiert hervorgehen. Schönheit ist emotionale Nahrung. In meinem Buch berichte ich zum Beispiel über die NGO Lemon Tree Trust, die in Camps für, unter anderem, syrische Geflüchtete aktiv ist. Sie bieten ihnen an, kleine Gärten zu gestalten und dafür aus einem Samenangebot zu wählen. 70 Prozent von ihnen entscheiden sich für Blumen, obwohl der Bedarf an frischen Lebensmitteln dort durchaus groß ist! Ein anderes Beispiel: Im Ersten Weltkrieg haben britische Soldaten in den Schützengräben an der Frontlinie Blumen gezüchtet!

Sie nennen den Garten eine Ko-Kreation von menschlichen und Natur-Energien, Sie betonen, dass es darüber hinaus um ein reziprokes Gestaltungssystem geht: Nicht nur wir gestalten den Garten, sondern er auch uns. Würden Sie Gärtnern als Kunst bezeichnen?
Es gibt eine große Spannbreite, aber es kann definitiv eine Kunstform sein. Einen Rasen anzulegen, würde ich eher nicht als Kunst bezeichnen sondern als funktional. Die großen Gärtner:innen waren dagegen in meinen Augen zweifellos Künstler:innen. Es kommt natürlich darauf an, inwieweit jemand kreativ ausdrücken kann, und auch darauf, ob das wahrgenommen wird. Das Komplexe daran ist, dass der Kunstbegriff sehr auf menschliche Kreativität gerichtet ist. In Hinblick auf den Garten müssen wir anders darauf schauen: Es geht im Tun und im Wahrnehmen um eine Beziehungsfähigkeit. Wenn die hergestellt ist, kann Gärtnern auch eine niederschwellige Kunstform sein, gerade, weil man die Wirkung nicht alleine hervorbringen muss und kann. Man setzt Dinge in Bewegung, man formt sie, passt sie an, bekommt eine Antwort, beobachtet, usw. Um diesen kreativen Dialog auf einem hohen Niveau künstlerisch zu gestalten, gibt es noch viele unausgeschöpfte Möglichkeiten.
Spannend finde ich, dass Sie in «Vom Wachsen und Werden» auch ethnologische Forschungen schildern. Sie zitieren Ethnologen, die die Gärten des Trobriand-Stammes auf Neu–Guinea für Kunst halten. Was darüber hinaus auffällt ist die gemeinsame Wurzel von Kunst und Gärtnern in Ritualen.
Zwar werden inzwischen teilweise Maschinen für das Gärtnern benutzt, aber im Grunde sind die Mechaniken und Techniken fast dieselben geblieben. Sie sind Jahrtausende alt. Es gibt keinen Grund, daran etwas zu ändern. Auch können seit dem 21. Jahrhundert so viel Dinge vollkommen unabhängig von der Jahreszeit machen, beim Gärtnern geht das nicht. Es ist eine der wenigen Tätigkeiten, die wir nicht sinnvoll automatisieren können. Rituale sind untrennbar mit dem Gärtnern verbunden, da es uns für die Zyklen und Dynamiken des Lebens sensibilisiert, und uns, indem es sie bestätigt, stabilisiert. Es gibt die Theorie, dass der Garten selbst das Ergebnis eines Rituals ist. So wurden in verschiedenen Kulturen die ersten Wildfrüchte eines Baumes den Göttern geopfert. An den Opferplätzen könnten die Samen der Früchte dann gekeimt haben und die Grundlage gelegt haben für das Entstehen eines Gartens.
Die europäische Vorstellung vom Garten ist noch kaum durch einen Dekolonialisierungsprozess gegangen. Was könnten wir lernen, wenn wir uns darum bemühten?
Vieles! Ich denke, das Wissen über Natur und Gärten, das in Teilen der Welt bestand, bevor sie kolonisiert wurde, war ein sehr ausgeprägtes, welches viel mehr in Resonanz war mit der Umwelt. Es wurde von der agrokulturellen Ideologie der Kolonisten als Wert komplett übersehen. Auch die Interpretation der Kulturgeschichte an sich ist teils mit groben, wenn nicht falschen Vorstellungen verbunden: Was wir die neolithische Revolution nennen, erzeugt oft die Vorstellung, dass die Jäger und Sammler begannen, Getreidefelder anzulegen, während es vielleicht vielmehr ein erhöhtes Bewusstsein für die Prozesse der nicht-domestizierten Natur war, was zur sogenannten landwirtschaftlichen Nutzung des Bodens führte – zum Beispiel das Entfernen von Giftpflanzen oder die Düngung mit Holzkohle.
Ein ausdifferenzierteres Verständnis des Gartens würde uns viele Lösungswege in Bezug auf die derzeitige ökologische Situation aufzeigen. Die Erde ist so komplex, wir sind gerade erst am Anfang, etwas davon zu begreifen. Deutsche Schrebergärten könnten zum Beispiel ein ausgezeichneter Ausgangspunkt sein, wenn das Konzept von Niedlichkeit, Zaunkultur und Aufgeräumtheit sich wandeln würde, und die Parzellen zu Orten der Biodiversität, zu Orten der Fürsorge zwischen Menschen und Natur würden. Es gibt noch so vieles zu tun, um die Beziehung zur Erde zu erlernen. Pädagogische Konzepte zu entwickeln, anhand derer bereits junge Kinder an ein eigenes Verhältnis mit der Natur herangeführt werden, könnte vieles verändern. Ich mache mir Sorgen, über den Grad von Niedergeschlagenheit, mit der sie im Verhältnis zum Zustand unseres Planeten aufwachsen. Es muss sich für sie oft so anfühlen, als sei schon alles zu spät, als könne man ohnehin nichts mehr tun. Wer in direkten Kontakt mit lebendigen Prinzipien kommt, sich verbinden kann, spürt dagegen auch Möglichkeiten und die Weisheit der Regeneration, die in der Natur – und damit letztlich in uns allen – steckt.
Dieses Interview erschien in einer gekürzten Fassung in der taz.